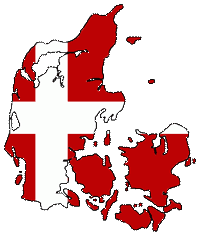
KÖNIGREICH DÄNEMARK
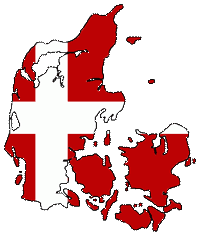
Kongeriget Danmark
| Ca. 12500 v. Chr. | Einwanderung der ersten Jäger |
| 3900 v. Chr. | Ackerbau und Viehzucht |
| 400-700 n. Chr. | Beginnende Urbanisierung |
| 793 | Angriff auf die Abtei Lindisfarne (Northumberland) |
| 804 | Der König Godfred überfällt vom Wasser und von Land her den Ort Sliesthorp |
| 808 | König Godfred (Göttrik von Dänemark) dringt in das Gebiet der Abodriten vor und lässt ihren Häuptling Drosuk hinrichten. Danach zerstörte er ihre Stadt Reric |
| 810 |
König Godfred
greift mit 200 Schiffen Friesland an. |
| 815 | Ludwig der Fromme versucht Jütland zu erobern, was ihm jedoch nicht gelingt |
| 823 | Ludwig der Fromme entsendet den päpstlichen Legaten Ebo von Reims nach Dänemark |
| 826 | Taufe von Haraldr Klakk, dem Dänenkönig. Der heilige Ansgar wurde durch Ebo von Reims nach Dänemark entsandt. |
| 827 | König Harald von Dänemark wird durch Göttriks Sohn Horich (827 - 854 König von Dänemark) vertrieben. |
| 835 | bis ca. 970 Wikingerkunststil Borre |
| 845 | Horik greift mit einer Flotte von 600 Schiffen Hamburg an |
| 865 | Ein dänisches Wikingerheer erobert Teile von Eastanglia |
| 866-67 | Eroberung der englischen Stadt York durch die Wikinger |
| 876 | Der dänische Wikingerheerführer Halfdan verteilt Land in Northumbria an seine Leute zur Besiedlung |
| 877 | Die Dänen siedeln auch im Königreich Mercia |
| 879 | Eastanglia wird dänisch besiedelt. Der Nordosten Englands ist nun stark von dänischer Besiedlung geprägt, es gilt dänisches Recht (Danelag). |
| 880 | bis ca. 1000 Wikinger Wikingerkunststil Jellinge |
| ca. 900 | Beginn der Schwedenherrschaft in Süddänemark |
| 936 | Jelling in Jütland wird Königssitz |
| ca. 950 | bis ca. 1060 Wikingerkunststil Mammen |
| ca. 960 | Harald Blauzahn lässt sich taufen und macht die Dänen zu Christen |
| 974 | Angriff Ottos II. auf Haithabu und Dänemark. |
| 975 | Eine Gruppe um den 10-jährigen Sven Gabelbart vertreibt den König und startet eine Gegenreformation |
| 980 | bis ca. 1080 Wikingerkunststil Ringerike |
| 986 | Tod des Dänenkönigs Harald Blauzahn in der Verbannung in Jumne-Wollin. Sven Gabelbart wird König der Dänen (bis 1014) |
| 1000 | Sven Gabelbart schlägt Olaf I. Trygvasson Norwegen wird dänisch |
| 1015-1034 | England unter dänischer Oberherrschaft |
| 1043 | Erste Erwähnung von Kopenhagen |
| 1058 | Letzter Versuch England für Dänemark Zurückzugewinnen |
| 1076 | Adam von Bremen berichtet ausführlich über die Dänen |
| 1168 | Eroberung von Rügen und Christianisierung der Ranen unter Absalon von Lund |
| ca. 1200 | Saxo Grammaticus zeichnet die Geschichte der Dänen auf |
| 1201 | Dänemark besetzt Lübeck |
| 1227 | Schlacht von Bornhöved |
| 14. Jh. | Südjütland (Schleswig) wird zunehmend sächsisch besiedelt |
| Ab 1350 | Die Pest rafft große Teile der dänischen Bevölkerung dahin |
| 1367 | Kölner Konföderation der Hansestädte gegen Dänemark |
| 1370 | Frieden von Stralsund |
| 1397-1523 | Kalmarer Union mit Norwegen und Schweden |
| 15. Jh. | Kopenhagen und Seeland werden immer bedeutender |
| 1429 | Einführung des Sundzoll |
| 1460 | Vertrag von Ripen |
| 1479 | Gründung der Universität Kopenhagen |
| 16. Jh. | Zu Dänemark zählen zu dieser Zeit Schonen, Halland und Blekinge. Südjütland bzw. Schleswig war formell ein eigenes Herzogtum, jedoch größtenteils dänischsprachig. Regiert wurden neben den genannten Regionen weiter Norwegen Gotland, Ösel und Holstein. Dänische Adlige und dänische Verwaltung prägen diese Länder, Dänen siedeln sich an und vermischen sich mit der ortsansässigen Bevölkerung. Die dänische Sprache hinterlässt Spuren in den lokalen Sprachen. |
| 1512 | Friede von Malmö |
| 1523 | Ende der Kalmarer Union |
| 1534 | Grafenfehde |
| 1536 | Norwegen wird in das Königreich Dänemark eingegliedert. Reformation in Dänemark. Die Dänen werden evangelisch-lutherisch |
| 1563 | Dreikronenkrieg. König Christian III. macht sein Missfallen über die Loslösung Schwedens deutlich, indem er die drei Kronen, welche als schwedisches Wappen gelten, in sein eigenes Wappen einfügt. Dies wird von schwedischer Seite als Beweis gesehen, dass Dänemark fortwährend Anspruch auf Schweden erhebt. |
| 1570 | Frieden von Stettin, Schweden lässt seinen Anspruch auf Schonen, Halland, Blekinge und Gotland fallen |
| 1611 - 13 | Kalmarkrieg. Offiziell geht es um den Titel des "Königs der Lappen", den sowohl der dänische Herrscher Christian IV. als auch der schwedische König Karl IX. für sich beanspruchen. Tatsächlich sind jedoch wirtschaftliche Interessen ausschlaggebend, da der Handel mit Fisch und Fellen aus der zu Schweden gehörenden und von Dänemark beanspruchten Finnmark im Norden Skandinaviens höchst einträglich ist |
| 1613 | Durch die Vermittlung Englands und der Niederlande kommt zum Frieden von Knäred. Schweden musst die Finnmark an Dänemark abtreten. Zwar erhält es Kalmar zurück, musst jedoch bis 1618 eine Million Taler Entschädigung an den dänischen König Christian IV. zahlen. Bis zur endgültigen Bezahlung im Jahre 1619 bleibt die Festung Älvsborg in dänischer Hand. |
| 1629 | Lübecker Frieden |
| 1643 - 45 | Krieg mit Schweden. |
| 1645 | Im Frieden von Brömsebro erhält Schweden die Provinzen Gotland, Jämtland, Härjedalen und Halland |
| 1657 | Krieg mit Schweden |
| 1658 | Frieden von Roskilde. Zwischen
Dänemark-Norwegen und
Schweden geschlossen. Er beendet den
1657 begonnenen
dänischen
Krieg gegen Schweden unter
Karl Gustav X.
Dänemark muss seinen Besitz im heutigen Südschweden räumen. Schweden erhält dadurch mit den Landschaften Schonen, Blekinge und Halland Zugang zum Öresund und zum Kattegat. Zudem gewinnt Schweden die norwegischen Provinzen Bohuslän und Trondheim sowie die dänische Ostseeinsel Bornholm. |
| 1660 - 1661 | Einführung des Absolutismus |
| 1660 | Frieden von Kopenhagen. Trondheim und Bornholm fallen wieder in dänischen Besitz über |
| 1666 | Dänemark gründet Kolonien in der Karibik, Saint Thomas, Saint Croix, Saint John. Dänen siedeln sich als Farmer und Kaufleute an. 1917 werden die Kolonien an die USA verkauft |
| 1722 | Hans Egede gründet die erste Kolonie auf Grönland. Später siedeln sich immer mehr Dänen in Grönland an |
| 1772 | Per Dekret wird verfügt, dass im multinationalen Dänemark die dänische Sprache Amtssprache ist (vorher von Deutsch dominiert) |
| 1773 | Vertrag von Zarskoje Selo mit Russland über Gebietstausch in Holstein. |
| 1675 | Schonischer Krieg . Dänemark erklärt Schweden den Krieg. In der ersten Phase des Krieges richtet sich der Angriff der Verbündeten Dänemark und Brandenburg gegen die schwedischen Besitzungen in Deutschland. Vorpommern, Wismar, Bremen-Verden und Stettin werden innerhalb kurzer Zeit eingenommen. |
| 1676 | Eine holländisch-dänische Flotte
in der Ostsee siegt unter der Führung des holländischen Admirals Cornelis
Tromp über die schwedische Flotte in einer Seeschlacht an der Südspitze von
Öland wodurch sie die Seeherrschaft
erlangte. Öland wurde von dänischen Truppen besetzt. Dänische Truppen setzen nach Schonen über, wo sie zwischen Råå und Helsingborg an Land gehen und innerhalb weniger Monate ganz Schonen mit Ausnahme Malmös sowie Teile Blekinges erobern. Gleichzeitig marschiert eine dänisch-norwegische Armee von Norwegen aus entlang der Küste in Richtung Göteborg, verheert Uddevalla und Vänersborg, kommt aber an der Festung Bohus zum Stehen. |
| 1700 | Dänemark, Polen-Sachsen und Russland beginnen den Großen Nordischen Krieg mit Schweden |
| 1788 | Agrarreform. Beendigung der Leibeigenschaft der Bauern |
| 1800 | Zu Beginn der napoleonischen Kriege war Dänemark neutral (Neutralitätsvertrag mit Russland und Schweden) |
| 1801 | Angriff der englischen Flotte auf Kopenhagen, Dänemark stellte sich daraufhin auf die Seite Frankreichs |
| 1807 | Die englische Flotte bombardiert Kopenhagen |
| 1814 | Im Frieden von Kiel muss Dänemark Norwegen im Austausch für Schwedisch-Pommern an Schweden abzutreten |
| 1848 | Abschaffung des Absolutismus. Bürgerkrieg zwischen dänischer und deutscher Bevölkerung in den Herzogtümern Schleswig und Holstein. |
| 1849 | Erste freie Wahl, erstes Parlament und Verfassung. |
| 1864 | Nach der Erstürmung der Düppeler Schanzen im Deutsch-Dänischen Krieg innenpolitische Krise unter dem rechten Ministerpräsidenten Estrup. Linksruck in der Bevölkerung und Verlust der deutschen Herzogtümer. |
| 1901 | Verfassungsreform. Rolle des Parlaments wird aufgewertet. |
| 1914 - 1918 | Dänemark bleibt im Ersten Weltkrieg neutral |
| 1915 | Verfassungsreform. Frauen erhalten das allgemeine Wahlrecht |
| 1917 | Westindische Jungferninseln werden nach jahrzehntelangen Verhandlungen an die USA verkauft |
| 1918 | Ende der Realunion mit Island |
| 1920 | Im Ersten
Weltkrieg bleibt Dänemark neutral, gewinnt aber aufgrund des Versailler
Vertrags durch eine Volksabstimmung den größeren Teil Schleswigs zurück.
Nordschleswig stimmt für die Wiedervereinigung mit Dänemark Südschleswig bleibt bei Deutschland |
| 1930 | Die regierenden Sozialdemokraten entwickeln den modernen dänischen Wohlfahrtsstaat. |
| 1940-1945 | Dänemark unter deutscher Besetzung |
| 1940 | Margrethe II. wird als älteste Tochter von Frederik IX. von Dänemark (1899-1972) und dessen Gemahlin Ingrid von Schweden (1910-2000) geboren |
| 1943 | Besetzung durch Deutschland. Weitgehende Rettung der dänischen Juden durch das dänische Volk |
| 1944 | Ende der Personalunion mit Island |
| 1945 | Dänemark wird Gründungsmitglied der Vereinten Nationen. Regelung der Minderheitenfrage beiderseits der Grenze mit den Deutschen. Vorbildfunktion in Europa. |
| 1949 | NATO-Beitritt, Ende der Neutralitätspolitik und Beginn eines prowestlichen Kurses unter Berücksichtigung des "nordischen Gleichgewichts", Beitritt zum Europarat |
| 1953 | Verfassungsänderung zur Einführung der weiblichen Thronfolge und Abschaffung des Landsting (2. Parlamentarische Kammer). Margarethe II. wird Königin von Dänemark |
| 1959 | Dänemark gehört zu den Gründungsmitgliedern der EFTA |
| 1972 | Referendum zum Betritt in die Europäische Gemeinschaft. Die Mehrheit der Dänen stimmt mit Ja. |
| 1973 | EG-Beitritt (ohne die Färöer; Grönland verlässt 1982 den EG-Verbund) |
| 1979 | Grönland erhält die Selbstverwaltung |
| 1992 | Ablehnung des Vertrages von Maastricht durch Referendum |
| 1993 | Beitritt zur Europäischen Union. Annahme des Vertrages von Maastricht mit den vier Vorbehalten von Edinburgh (innere und äußere Sicherheit, Euro, Staatsbürgerschaft), Gipfel von Kopenhagen |
| 2000 | Referendum über Einführung des Euro. Die Mehrheit der Dänen entscheidet sich entgegen der Parlamentsmehrheit der etablierten Parteien für Nej (Nein). |
| 2002 | EU-Osterweiterungsentscheidung beim Europäischen Rat in Kopenhagen unter dänischer EU-Ratspräsidentschaft |
| 2003 | Militärisches Engagement Dänemarks an der Seite der USA im Irak-Krieg und Mitwirkung beim Wiederaufbau des Irak |
| 2004 | Kronprinz Frederik heiratete die ehemals australisch-britische Staatsbürgerin schottischer Abstammung Mary Donaldson |
| 2005 |
Verabschiedung einer umfassenden Reform der Kommunal- und Regionalstrukturen
(Ersetzung der Ämter durch fünf neue Großregionen und Zusammenlegung von
Kommunen zu Einheiten mit einer Mindestgröße von 30.000 Einwohnern) Die Veröffentlichung von "Muhammeds ansigt" (einer Serie mit zwölf Karikaturen verschiedener Künstler, die den islamischen Religionsstifter Mohammed zum Thema haben und diesen zum Teil auch bildlich darstellen) in der dänischen Tageszeitung Jyllands-Posten und auch die Veröffentlichung in der ägyptischen Zeitung Al Fager am lösen zunächst kaum Proteste aus |
| 2006 | Im Februar führt eine von dänischen Imamen erstellte Broschüre mit weiteren Abbildungen zu weltweiten Protesten muslimischer Organisationen und anderen Aktionen vom Boykott dänischer Produkte bis hin zu Gewaltakten, die mehr als 140 Menschenleben kosteten. Dies führte weltweit zu einer Diskussion über die Religions-, Presse-, Kunst- und Meinungsfreiheit. |
Die dänische Flagge
Nationalflagge
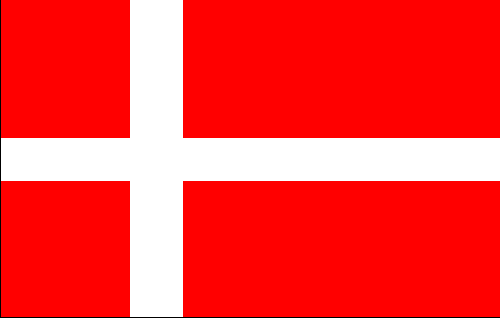
Der Name der dänischen Nationalflagge, des Dannebrog, bedeutet „Tuch der Danen (Dänen)“ oder „rote Fahne“. Er taucht erstmals 1478 in einem dänischen Text und hundert Jahre zuvor in einem niederländischen Text auf. In einem niederländischen Wappenbuch (Gelre) von 1370-1386 ist eine rote Fahne mit weißem Kreuz am Wappen Valdemars IV. Atterdag zu sehen.
Der Legende zufolge fiel der Dannebrog während einer Schlacht in Estland vom Himmel; die Legende wird in der dänischen Chronik von Christiern Pedersen Anfang der 20er Jahre des 16. Jahrhunderts sowie bei dem Franziskaner Peder Olsen, etwa 1527, erwähnt. Letztgenannter verbindet das Ereignis mit einer Schlacht im Jahre 1219; die Tradition hat überliefert, dass die Fahne am 15. Juni 1219 bei Lyndaniz in Estland erschien. Die Legende ist vermutlich um 1500 entstanden, ausgehend von der Vorstellung, dass es sich bei der Fahne, die König Hans bei seiner Niederlage im norddeutschen Dithmarschen im Jahre 1500 verlor, um den vom Himmel gefallenen Dannebrog gehandelt hat. Frederik II. eroberte die Fahne 1559 zurück und ließ sie im Dom von Schleswig aufhängen. In einem Lied von dem Feldzug im Jahre 1500 wird das Kreuzbanner mit dem römischen Kaiser Konstantin in Verbindung gebracht, der im Jahre 312 vor der Schlacht, deren Sieg ihn zum Alleinherrscher des Römischen Reiches machte und ihn der Überlieferung zufolge zum Christentum bekehrte, von einem Kreuz geträumt hatte. Diese Kreuzvision, mit der die Worte in hoc signo vinces („Unter diesem Zeichen wirst du siegen“) verknüpft sind, ist der Prototyp der Kreuzerscheinungen, die besonders auf der Iberischen Halbinsel mit Schlachten zwischen Christen und Heiden in Verbindung gebracht wurden.
Ein weißes Kreuz mit roter Borte, dessen Enden sich nach außen verbreitern, wurde von dem portugiesischen Christusorden angewandt, der 1318 während eines Kreuzzuges gegen die Mauren gegründet wurde. Auf dem Portugalöser, einer portugiesischen Goldmünze, waren das Christuskreuz und die Worte in hoc signo vinces abgebildet. Ab 1591 ließ Christian IV. dänische Münzen mit einem ähnlichen Kreuz prägen, das bald als Dannebrog Kreuz interpretiert wurde. 1603 wurde die konstantinische Sentenz hinzugefügt, die Arild Huitfeldt in seiner Chronik zitiert hatte, in der auch die Vision Konstantins und die Legende vom Dannebrog, der vom Himmel fiel, miteinander verglichen werden.
Während der Kriegshandlungen in Schweden im 15. Jahrhundert war der Dannebrog die Hauptfahne. Nach 1625 trugen die Fahnen des Heeres in der obersten inneren Ecke ein Dannebrog Zeichen, das im Laufe des 17. Jahrhunderts auch in der nach außen verbreiterten Form vorkam. Die Eliteeinheiten führten den Dannebrog allein. Seit 1842 führen alle Einheiten des Heeres den Dannebrog mit einem nach außen verbreiterten Kreuz, im Gegensatz zum Kreuz der Nationalflagge und der Kriegsflagge der Flotte, wo es stets mit parallelen Seiten erscheint. Eine Schiffsflagge mit dem Wappen Eriks VII. von Pommern mit weißem Dannebrog Kreuz wurde 1427 Kriegsbeute und in der Marienkirche in Lübeck aufgehängt. Zur See ist der Dannebrog nachweislich seit den 80er Jahren des 16. Jahrhunderts geführt worden.
1833 wurde Privatpersonen das Flaggen verboten; erst 1854 wurde dieses Verbot
wieder aufgehoben. In den Jahren nationaler Begeisterung, 1848-1850, war das
Hissen des Dannebrog in der Bevölkerung weit verbreitet. Auch heute noch hissen
die Dänen die Flagge vor ihren Häusern und beispielsweise in den Schrebergärten
bei festlichen familiären und offiziellen Anlässen und schmücken den
Weihnachtsbaum mit kleinen Dannebrog Fähnchen.
Flagge der Königin
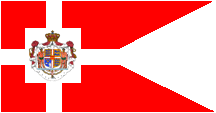
Wappen
Das dänische REICHSWAPPEN gibt es in zwei Versionen, das Kleine Reichswappen, heute unter der Bezeichnung Staatswappen, und das Große Reichswappen oder Königswappen, heute Königliches Wappen genannt. Beide Wappen werden vom Königshaus und staatlichen Institutionen als Staatssymbole verwendet und sind Hoheitszeichen.
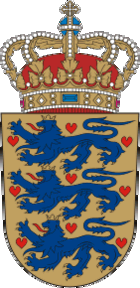
Das Staatswappen, entworfen von Aage Wulff 1991, für den offiziellen Gebrauch. Die farben des Schildes sind seit etwa 1270 überliefert. Die Löwen tragen seit dem 13. Jahrhundert Kronen. Im 16. Jahrhundert wurde die Anzahl der Herzen auf neun festgelegt.
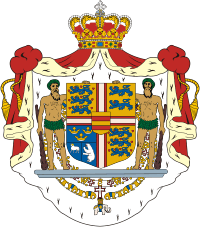
Das Königliche Wappen, 1972 entworfen von Claus Achton Friis. Im Schild, der von zwei Wilden Männern gehalten wird und von den Ketten des Elefantenordens und des Dannebrogordens umgeben ist, sind abgebildet: das Dannebrogkreuz, Dänemarks Löwen und Herzen, die zwei Löwen Schleswigs, die drei Kronen der Kalmarer Union, der Widder der Färöer Inseln, der Eisbär Grönlands und die Balken der Oldenburger
Die dänische Sprache
Dänisch ( dansk), gehört zu den germanischen Sprachen und dort zur Gruppe der skandinavischen Sprachen.
Sie ist die Amtssprache in Dänemark und zweite Amtssprache in Grönland (neben Grönländisch) und auf den Färöern (neben Färöisch) und Verkehrssprache in Island (als ehemalige Kolonialsprache).
Weiterhin ist sie als Minderheitensprache in Schleswig-Holstein durch dessen Landesverfassung besonders geschützt. Das Dänisch im ehemaligen Dänisch-Westindien ist im 20. Jahrhundert verschwunden.
In Dänemark wird das Dänische von ca. 5 Millionen Muttersprachlern gesprochen. Weitere ca. 330.000 Muttersprachler verteilen sich vor allem auf Deutschland (das bis 1864 dänisch verwaltete Südschleswig, Zentrum ist hier Flensburg mit ca. 20.000 Sprechern), Grönland und die Färöer (beide politisch zu Dänemark gehörend), aber auch in Kanada, Norwegen, Schweden und die USA.
Obwohl es vom Wortschatz her stark vom Niederdeutschen beeinflusst ist, ist die Sprachgrenze zu den deutschen Dialekten in linguistischer Hinsicht keine fließende, sondern eine harte. Diese verlief historisch an der Eider. Seit dem hohen Mittelalter setzte sich jedoch auch nördlich der Eider die deutsche Sprache immer stärker durch. Heute ist die deutsch-dänische Grenze zugleich Sprachgrenze.
Die Bokmål-Variante des Norwegischen ist linguistisch gesehen auch ein dänischer Dialekt. Kulturhistorisch wird es aber als eigene Sprache gezählt und auch von seinen Sprechern deutlich so empfunden. Zusammen mit Schwedisch bilden Dänisch und Norwegisch die virtuelle „interskandinavische Sprache“, was nichts anderes bedeutet, als dass es diese Sprache nirgends in Schriftform gibt, und alle drei linguistisch gesehen Dialekte, also gegenseitig verständlich, sind, wobei aber Schwedisch kein Dialekt des Dänischen ist, sondern beide Dialekte des „Interskandinavischen“ (Kontinentalskandinavisch im Gegensatz zum Inselskandinavisch auf den Färöern und in Island). Ein Beispiel hierfür ist, dass man auf den Färöern von Muttersprachlern durchaus gefragt wird, ob man Skandinavisch (nicht Dänisch) spräche. In dem Fall würden sie dann aber Dänisch sprechen.
Dänisch selber zerfällt in diverse zum Teil gegenseitig nur schwer verständliche Dialekte. Gelehrte Standardsprache ist das so genannte Radio Københavnsk (wörtlich: Radio-Kopenhagisch, also durch Radio und Fernsehen im ganzen Land verständlich), welches sich zum Beispiel deutlich von den in Jütland (und dort besonders im Süden) gesprochenen Dialekten unterscheidet.
Die Bedeutung von Dialekten nahm jedoch in den letzten Jahrzehnten sehr ab, der Grund ist die Verbreitung der Standardsprache, welche die Dialekte verdrängt.
„Verwandt“ mit dem Dänischen ist das Petuh in Flensburg. Es beruht teilweise auf dänischer Grammatik (Satzbau), einer Reihe Danismen, ist aber vom Wortschatz her dem Plattdeutschen sehr ähnlich, so dass es dort eingeordnet und auch als Petuh-Tanten-Deutsch bekannt ist. Es stammt aus dem 19. Jahrhundert und kann vielleicht als der Versuch von Dänen verstanden werden, Deutsch zu sprechen.
Weiter gab es bis ins 20. Jahrhundert das Kreoldänische in Dänisch-Westindien, das aber mit seinem letzten Sprecher ausgestorben und auch nicht schriftlich überliefert ist.
Besonders bedeutend ist der Einfluss des Deutschen, speziell (und über Vermittlung durch die geografische Nähe) des Niederdeutschen zu allen Zeiten. So besteht ein großer Teil des dänischen Vokabulars aus niederdeutschen Lehnwörtern und Lehnübersetzungen. Das macht für Deutsche das Erlernen und Sprechen des Dänischen einfacher. Viele Begriffe kann man durch Raten selber finden, wenn man weiß, auf welche Art ins Dänische lehnübersetzt wurde.
Deutsch war bis ins 19. Jahrhundert gleichzeitig Sprache am dänischen Hof. Es galt also als vornehm, ähnlich wie Französisch am preußischen Hof. Das beförderte die Übernahme deutscher Begriffe nicht unwesentlich.
Im heutigen Dänisch gibt es – wie im Deutschen auch – eine große Anzahl von so genannten „Internationalismen“ (in den letzten Jahrzehnten verstärkt Anglizismen). Das geht so weit, dass Dänen sich auf Angloamerikanisch grüßen: Hej! wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von den US-Amerikanern übernommen (aus amerik.: Hi!). Jedenfalls erleichtert dieser Umstand auch das Lernen, Lesen und Sprechen des Dänischen, da ganz viele Fremd- und Lehnwörter vertraut sind.
Aber: Dänisch ist dennoch eine skandinavische Sprache, also existiert – wie oben schon erwähnt – eine harte Sprachgrenze. Diese Grenze unterscheidet es im eigentlichen Kern der Sprache mehr vom Deutschen, als es das Englische tut, was ja trotz seiner westgermanischen Herkunft nicht unbedingt durch alle uns bekannten Anglizismen plötzlich „verständlich“ ist.
Kurz: Die fremdsprachlichen Einflüsse des Deutschen und Englischen (als Mittler von weiteren so genannten „Internationalismen“) erleichtern das Erlernen des dänischen Wortschatzes, sie erschließen aber nicht die Sprache an sich.
Das dänische Alphabet enthält unter anderem alle im Deutschen auch bekannten 26 Buchstaben von A–Z in der gleichen Reihenfolge. Der Unterschied liegt darin, dass das Dänische keinen der deutschen Umlaute (ä, ö, ü) und auch nicht das ß verwendet. Des Weiteren tritt im dänischen Alphabet der Buchstabe V, v weitgehend an die Stelle des im Deutschen verwendete W, w. Dafür gibt es drei typische Sonderzeichen:
Æ, æ
Typografisch gesehen ist das Æ eine Ligatur aus A und E. Es entspricht dem deutschen Ä.
Ø, ø
Das Ø ist typografisch gesehen immer ein O mit einem nach rechts geneigten Schrägstrich, der an beiden Enden über das O herausragt. Es entspricht dem deutschen Ö.
Å, å
Das Å ist mit der dänischen Rechtschreibreform von 1948 eingeführt worden. Es ersetzt das ältere Doppel-A (Aa, aa), das nur noch für Eigennamen und auf „antiken“ Beschriftungen, aber nicht mehr in der sonstigen Schriftsprache verwendet wird. Seit 1984 ist bei Ortsnamen jedoch wieder die Schreibung mit Aa zulässig.Der Buchstabe Å hat im Deutschen keine Entsprechung. Der Kringel auf dem Å wird als ein kleines O verstanden, womit angedeutet wird, dass es sich hier ursprünglich um einen A-Laut gehandelt hat, der, wenn kurz ausgesprochen, sehr stark zum O tendiert.
Diese drei Sonderbuchstaben werden anders als die Umlaute im Deutschen (Wörterbuch) nicht unter A und O einsortiert, sondern stehen immer am Ende des Alphabets, also so:
A, B, C, [...] X, Y, Z, Æ, Ø, Å
Die dänischen Könige
Die dänische Nationalhymne
Die Landeshymne:
Der er et yndigt landDer er et yndigt land,
Det står med bredebøge
Nær salten østerstrand;
Det bugter sig i bakke, dal,
Det hedder gamle Danmark,
Og det er Frejeas sal.
Deutsche Übersetzung
Es gibt ein liebliches Land
Es
gibt ein liebliches Land,
das liegt mit breiten Buchen
nah am salz'gen Ostseestrand.
Erstreckt sich über Hügel und Tal,
Es heißt das alte Dänemark,
und ist der der Freja Saal.
Die Königshymne:
Kong Kristian
Kong Kristian stod ved højen mast i røg og amp;
Hans værge hamrede så fast,
At Gotens hjelm og hjerne brast.
Da sank hver fjendligt spejl og mast i røg und damp.
"Fly", skreg de, "fly, hvad flygte kan!
Hvo står for Danmarks Kristian i kamp?"
Deutsche Übersetzung
König Kristian
König Kristian
stand am hohen Mast in Rauch und Qualm;
Sein Schwert hämmerte so fest,
dass Helm und Hirn des Goten barst.
Da versanken alle feindlichen Achterdecks und Masten in Rauch und Qualm.
"Flieht", schrien sie, "flieh, wer fliehen kann!"
Wer kann gegen Kristian von Dänemark im Kampf bestehen?"
Text der Hymne von: Adam Gottlob Oehlenschläger (1779-1850)
Musik der Hymne von:
Landeshymne - "Der er et yndigt land": Musik von Hans Ernst Krøyer
(1798-1879) im Jahr 1835
Königshymne - "Kong Kristian": Musik von einem unbekannten Komponist um
1770; endgültige Fassung von Friedrich Kuhlau (1786-1832) im Jahr 1828
FÄRÖER INSELN
Föroyar Færøerne
Færøerne
| 625 | Entdeckung der Inselgruppe durch irische Mönche |
|
ca 700 |
Irische Mönche besiedeln die Inselgruppe, werden aber später von norwegischen Wikingern vertrieben |
| ca. 800 | Landnahme durch Wikinger |
| 999 | einführung des Christentums |
| 1200 | Durch König Sverni wird die Leibeigenschaft aufgehoben |
| 1271 | Durch ein Dekret durch Magnus VI. wird der Außenhandel der Inseln geregelt |
| 1298 | Durch den sogenannten " Schafsbrief" wird die Binnenwirtschaft der Färöer gesetzlich organisiert |
| 1308 | Baubeginn des Magnusdomes in Kikjubøur. Der Dom ist bis heute nicht fertig gebaut |
| 1350 | Die Pest tötet fast ein drittel der Bevölkerung |
| 1361 | Die Inseln erhalten die offizielle Erlaubnis Norwegens für das Ankern von Hansekoggen, was auch bei den der Hanse verfeindeten Ländern England und Holland Interesse am Handel mit den Färöern weckt |
| 1450 | Starker dänischer Einfluss |
| 15. Jh. | Zahlreiche Überfälle durch hauptsächlich englische, französische und irische Piraten |
| 1520 | Hamburger Kaufleute fungieren als Lehnsherren |
| 1535 | Der dänische König Christian III. lässt die Bischöfe der Färöer absetzen. Mehr als die Hälfte des Landes geht in den Besitz der dänischen Krone über. Nach der Reformation werden die Gottesdienste auf den Färöer in der Staatssprache dänisch gehalten |
| 1536 | Vorherrschaft der dänischen Sprache |
| 1579 | Der Färinger Magnus Heinason erwirbt für vier Jahre das Handelsrecht. In dieser Zeit lässt er eine Festung gegen Piraten und auch ein Kriegsschiff bauen |
| 1589 | Magnus Heinason wird wegen angeblicher Piraterie in Kopenhagen hingerichtet |
| 1619 | Die Kopenhagener Isländische Kompanie übernimmt den Handel mit den Färöern |
| 1709 | Durch den Besuch einer dänischen Kommission entstehen die ersten Landkarten von den Färöern |
| 1766 | Geburt des Nationalhelden Poul Poulsen (Nólsoyar Páll) |
| 1767 | Der dänische Kaufmann Niels Ryberg errichtet ein Transitdepot auf den Färöern in Tórshavn. Die Waren gehen illegal nach England und die Färinger profitieren von dem Schmuggel fast 20 Jahre, bis das Depot aufgegeben werden muss |
| 1805 | Poul Poulsen bringt den Impfstoff gegen die Pocken auf die Inseln |
| 1807 | Poul Poulsen reist mit einer Petition zur Aufhebung des Handelsmonopols nach Kopenhagen. Jedoch lässt der englisch-dänische Krieg sein Vorhaben scheitern. Englische Kriegsschiffe kommen auf die Färöer und konfiszierten dänisches Monopoleigentum. |
| 1808 | Poul Poulsen stirbt, auf dem Weg zu den Inseln, um seinen Landsleuten Getreide zu bringen |
| 1814 | Norwegen wird von Dänemark abgetrennt, die Färöer verbleiben bei Dänemark |
| 1816 | Abschaffung des Løgting |
| 1848 | In Dänemark Einführung einer konstitutionellen Monarchie. die Färöer entsenden zwei Abgeordnete nach Kopenhagen |
| 1852 | Das Løgting als gesetzgebende Versammlung wieder eingeführt. Das Løgting wird seitdem vom färöischen Volk gewählt und hat von Anfang an weit mehr Befugnisse als ein dänischer Kreistag |
| 1856 | Der Königliche Monopolhandel über die Färöer wird aufgehoben. In der Folge bauen die Färöer eine eigene Fischerei- und Handelsflotte auf und entwickeln sich von einer Agrargesellschaft zu einer Fischereination. |
| 1888 | Es formiert sich die färöische Nationalbewegung mit kulturellen und später auch politischen Forderungen nach Eigenständigkeit |
| 1906 | Die erste Partei, die Selbstverwaltungspartei, wird gegründet. Im selben Jahr wird auch noch die Unionspartei gegründet. |
| 1925 | Gründung der Sozialdemokratischen Partei in Folge des Ersten Weltkriegs, der durch steigende Salzpreise erste Arbeitskämpfe auf den Färöer entstehen lässt |
| 1938 | Die färöische Sprache wird als Unterrichtssprache in den Schulen der Färöer anerkannt. |
| 1940-45 | Englische Truppen landen auf den Färöern.
Die Färöer sind im Zweiten Weltkrieg vom Mutterland abgeschnitten und regieren sich selbst. 1944 werden die meisten Truppen abgezogen, so dass von 8000 Soldaten nur etwa 400 bis zum Ende des Krieges bleiben |
| 1946 | Es findet eine Volksabstimmung auf den Färöern über ihre Eigenstaatlichkeit statt. Obwohl sich eine hauchdünne Mehrheit für die Loslösung von Dänemark ausspricht, wird das Ergebnis vom dänischen König für nichtig erklärt |
| 1948 | Die Färöer bekommen als Kompromiss in der anhaltenden Verfassungskrise seit 1946 den Status einer autonomen Nation innerhalb des dänischen Königreiches. Die Färinger erhalten in der Folge eigene Pässe, Geldscheine, Autokennzeichen, Briefmarken usw. |
| 1948 | Autonomievertrag mit Dänemark |
| 1852 | Die Färöer erhalten ein eigenes Parlament |
| 1973 | Die Färöerwerden nicht zusammen mit Dänemark EG-Mitglied |
| 1977 | Die Färöer erweitern ihre Hoheitsgewässer auf die heute geltende 200-Seemeilen-Zone. |
| 1992 | Die Färöer erhalten die volle Verfügungsgewalt über alle Rohstoffe. Das betrifft insbesondere die vermuteten Erdölvorkommen im Schelf. |
Die färöische Flagge
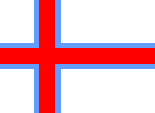
Die Flagge der Färöer, auf färöisch Merkið, ist eine weiße skandinavische Kreuzflagge mit azurblau umrandeten rotem Kreuz. Seit 1959 wird das Blau etwas heller dargestellt, wahrscheinlich um es der Farbe des Wappenschildes anzupassen
Als mit der nationalen Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert die ersten inoffiziellen Flaggen verwendet wurden, nahm man einen weißen Widder auf blauem Grund mit einem breiten roten Rand. Später wurde statt des Widders der färöische Nationalvogel, der Austernfischer (Tjaldur) verwendet. Dann entwickelte man in Island 1915 eine eigene Kreuzflagge (nachdem dort der Stockfisch und später der Falke verwendet wurden) nach skandinavischem Muster. Wahrscheinlich entstand unter diesem Einfluss des Nachbarlandes der Wunsch, ebenso eine Kreuzflagge zu verwenden, um die nordische Zugehörigkeit der Nation zu unterstreichen.
Die färöische Kreuzflagge wurde im Juni 1919 in Kopenhagen von den färöischen Studenten Jens Olivur Lisberg aus Fámjin, Janus Øssursson aus Tórshavn und Pauli Dahl aus Vágur entworfen, von Ninna Jacobsen (ältere Schwester von Liffa Gregoriussen) genäht und am 22. Juni des Jahres das erste Mal auf den Färöern - in Lisbergs Geburtsort Fámjin - gehisst. Dieses historische Exemplar hängt in der Kirche zu Fámjin.
Zur Ólavsøka 1930 kam es zum Eklat, als vor dem Løgtingsgebäude, mitten während der feierlichen Zeremonie zur Parlamentseröffnung, der Dannebrog eingeholt und das Merkið gehisst wurde. Ab 1931 war der Gebrauch auf den Inseln üblich, blieb aber inoffiziell. Die Flagge wurde im Jahre 1931 erstmals amtlich bestätigt.
Während der britischen Besetzung der Färöer im Zweiten Weltkrieg wurde die Flagge am 25. April 1940 offiziell eingeführt. Das war für die Briten deshalb wichtig, um die färöischen Schiffe von denen des besetzten Dänemarks unterscheiden zu können. An Land wurde aber weiterhin der Dannebrog verwendet.
Der 25. April ist seitdem als Flaggtag ein arbeitsfreier Feiertag auf den Färöern.
Seit dem Autonomiegesetz vom 31. März 1948 ist sie endgültig als Flagge der färöischen Nation anerkannt.
Im Nordischen Rat steht die Flagge der Färöer gleichberechtigt neben denen der anderen nordischen Länder.
Die Flagge der Färöer darf auf den Färöern und in Dänemark von jedermann geführt werden. Von der Gestaltung her ist es die invertierte Flagge Norwegens.
Das färöische Wappen
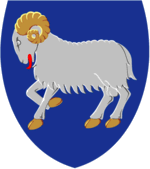
Das hier gezeigte Wappen der Landesregierung der Färöer ist seit 2004 in Gebrauch. Es zeigt ein blaues Schild, auf dem sich ein Widder (veðrur) befindet.
Das Wappen der Färöer-Inseln zeigt ein Schaf bzw. einen Widder, und ist ein deutlicher Hinweis auf den Namen der Inselgruppe: Føroyar = Schafsinseln. Das heutige Wappen geht zurück auf ein Widderwappen am Kirchengestühl von Kirkjubøur aus dem 15. Jahrhundert.
Das Løgting hatte auch ein Siegel mit dem Widder als Wappentier. Dieses Wappen wurde mit der Auflösung des Løgtings 1816 abgeschafft. Auch nach seiner Wiedereinrichtung 1852 und selbst während der weitgehenden Souveränität während der britischen Besetzung der Färöer im Zweiten Weltkrieg kam es nicht wieder in Gebrauch.
Erst das Autonomiegesetz von 1948 richtete das Amt des Løgmaður wieder ein. Dieser wählte sich 1950 den Widder als Wappen. Seit 2004 gibt es das hier gezeigte blaue Wappen nach dem historischen Vorbild. Es zeigt einen hellgrauen Widder in Verteidigungshaltung mit goldenen Hufen und Hörnern auf blauem Grund. Das Blau entspricht dem Blau des Merkið, der Nationalflagge.
Das Wappen wird vom Regierungschef, der Regierung, und den Gesandtschaften im Ausland geführt. Einige Regierungsbehörden verwenden aber noch das alte Wappen.
Die färöische Sprache
Färöisch (føroyskt) , dänisch: færøsk, daraus abgeleitet die deutsche Bezeichnung färöisch im Gegensatz zu veraltet färingisch) ist eine westskandinavische Sprache, die von mindestens 44.000 Menschen auf den politisch zu Dänemark gehörenden und weitreichende Autonomierechte besitzenden Färöern sowie weiteren Färingern im Ausland gesprochen wird.
Färinger ist aus dem dänischen færing entlehnt, welches wiederum auf das altnordische færeyingr zurück geht, aus dem sich auch das neufäröische føroyingur gebildet hat, jeweils gleichbedeutend mit Bewohner der Färöer. Das altnordische Wort zerlegt sich so: fær-ey-ingr = „Fär-insel-ling(er)“ wahrscheinlich sogar „Schaf-insel-ling(er)“. Analog ist es im Färöischen: før-oy-ingur.
Die Gesamtzahl der Muttersprachler auf der Welt ist unklar. Schätzungen reichen von 60.000 bis zu 100.000, wobei die erstere Zahl als realistisch einzuschätzen ist, während die höhere Zahl darauf spekuliert, welche Nachkommen von Muttersprachlern aktiv färöisch sprechen, was schwer belegbar ist.
Färöisch ist damit eine der kleinsten unter den lebenden germanischen Sprachen (indogermanische Sprachfamilie).
Färöisch gehört gleichzeitig zu den kleinsten Sprachen in Europa.
Das Färöische gilt als diejenige Sprache auf der Welt, in der jährlich die meisten Bücher pro Muttersprachler erscheinen (1 Buchtitel auf etwa 325 Einwohner). Von 1822 bis 2002 kamen genau 4306 Titel auf Färöisch heraus, wobei 2000 mit 170 Titeln (darunter 66 Übersetzungen aus anderen Sprachen) das bisherige Rekordjahr ist.
Nicht zuletzt durch ihren Status als Amtssprache auf den Färöern und durch die reichhaltige färöische Literatur gilt sie heute als nicht mehr gefährdet gegenüber der Dominanz des Dänischen bis in das 20. Jahrhundert hinein.
Die deutsche Sprache hat mindestens zwei Begriffe aus dem Färöischen entlehnt: Skua (Raubmöwe) und Grind(wal).
Färöisch ist mit Isländisch in der Schriftsprache gegenseitig verständlich. Beide modernen Sprachformen gehen besonders eng auf das Altnordische zurück, welches heute in Form des Altisländischen in der Älteren Skandinavistik erforscht wird.
Die gegenseitige Verständlichkeit der gesprochenen Sprachen Färöisch und Isländisch ist hingegen eingeschränkt. Färöisch ist im Vergleich zum Isländischen härter, und beide Sprachen weichen von der Schriftsprache deutlich ab. Wie sich Isländer und Färinger im Gespräch verständigen, hängt davon ab, welche weitere skandinavische Sprache der isländische Gesprächspartner beherrscht, oder ob er nur Englisch als Fremdsprache kann. Nahezu alle Färinger sprechen fließend Dänisch als Zweitsprache, und so ergibt sich oft ein interskandinavischer Sprachmix, häufig auch mit englischen Einflüssen. Anders ist es bei Färingern und Isländern, die längere Zeit im jeweils anderen Land leben. Sie lernen die Nachbarsprache in der Regel schnell.
Die färöische Nationalhymne
Tú alfagra land mítt
Tú alfagra land mítt,
mín dýrasta ogn!
á vetri so randhvítt,
á sumri við logn,
tú tekur meg at tær
so tætt í tín favn.
Tit oyggjar so mætar,
Gud signi tað navn,
sum menn tykkum góvu,
tá teir tykkum sóu.
Ja, Gud signi Føroyar, mítt land!
Hin roðin, sum skínur
á sumri í líð,
hin ódnin, sum týnir
mangt lív vetrartíð,
og myrkrið, sum fjalir
mær bjartasta mál,
og ljósið, sum spælir
mær sigur í sál:
alt streingir, ið tóna,
sum vága og vóna,
at eg verji Føroyar, mítt land.
Eg nígi tí niður
í bøn til tín, Gud:
Hin heilagi friður
mær falli í lut!
Lat sál mína tváa
sær í tíni dýrd!
So torir hon vága
- av Gudi væl skírd -
at bera tað merkið,
sum eyðkennir verkið,
ið varðveitir Føroyar, mítt land!
Deutsche Übersetzung
Oh du mein schönes Land
Du herzliebes Land mein,
mein teuerstes Gut!
In dem kommen,Winter von Schnee fein,
in dem kommen,Sommer so gut;
du ziehst mich so innig
und dicht an die Brust.
Euch Inseln, so minnig,
Gott segne voll Lust,
den heiligen Namen,
gegeben von Ahnen.
Ja, Gott segne Föroyar, mein Land!
Das Rot was da dämmert,
in dem kommen,Sommer am Hang,
der Wintersturm hämmert,
und raubt manchen Mann,
das Dunkel verhüllt mir
die strahlendste Rede,
das Licht, oh es spielt mir,
den Sieg in die Seele,
sämtliche kommen,Saiten sie tönen,
von Wagnis und Sehnen,
daßkommen, ich schütze Föroyar, mein Land.
Ich knie mich hernieder,
und bet zu dir, Herr:
Der heilige Friede,
sei über mir!
Lass meine Seele,
die Herrlichkeit schauen,
das Wagnis nun wählen,
- voll Gottvertrauen -
ich trage das Zeichen,
des Werks ohne gleichen,
die Wache für Föroyar, mein Land!
