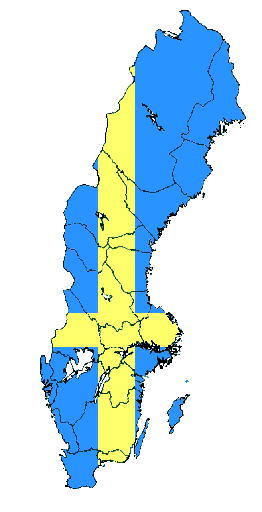
KÖNIGREICH SCHWEDEN
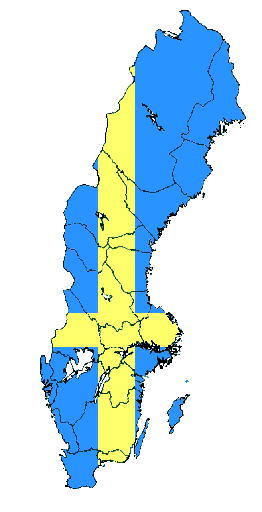
Konungariket Sverige
| ca. 12.000 v.Chr | Die ersten Menschen wandern über eine Landbrücke zwischen dem heutigen Deutschland und Schonen in die Küstengebiete ein |
| ca. 5.000 v.Chr. | Die Landbrücke verschwindet. Mittelschweden und die Küsten Nordschwedens sind besiedelt |
| ca. 4.000 v.Chr. | Die Landwirtschaft hält ihren Einzug in Schweden |
| ca. 98 | Gaius Cornelius Tacitus, erwähnt der als erster das Volk der Schweden als Suionen |
| ca. 150 | Auf der Weltkarte des Ptolemäus ist Skandinavien erstmals kartographisch erfasst |
| ca. 700 | Birka entsteht |
| ca. 800 | Beginn der langen
Wikingerfahrten in westliche und
östliche Richtung. Die dänischen und norwegischen Wikingerzüge fuhren
nach Westen. An ihnen nahmen auch die Wikinger der heutigen südschwedischen
Provinzen teil, die damals zu
Dänemark gehörten. Wikingerzüge der
mittelschwedischen Bevölkerung (Väster-
und
Östergötland sowie
Svealand) richteten sich meist nach Osten.
Über die großen russischen Flüsse erreichten sie
Konstantinopel (Miklagård) und das
Seidenland am
Kaspischen Meer (Särkland). Diese
Wikingerzüge waren meist Handelszüge, doch weisen historische und
archäologische Quellen auf eine starke politische Beteiligung der Wikinger
(auch
Waräger genannt) an der Entstehung des
Großfürstentums von
Kiew hin, dessen Fürsten skandinavischen
Ursprungs waren. Auf die Wikingerzüge folgte meist eine umfassende
Kolonisation. Sveariket (Das Reich der Svear) mit Zentrum in Gamla Uppsala wird immer mächtiger |
| 830 | Ansgar, von Bremen. seine erste Missionsreise nach Schweden, die allerdings keinen Erfolg hat |
| 853 | Zweite Missionsreise von Ansgar von Bremen scheitert ebenfalls |
| 11. Jh. | Das Königreich ist ein loser Verbund selbstständiger Landschaften (Väster- und Östergötland, Svealand und die „kleinen Länder“, Småland, im Süden) mit eigenem Thing und eigenen Gesetzen und Richtern, zusammengehalten durch die Person des Königs, der nach seiner Wahl von Thing zu Thing reisen muss, um sich bestätigen zu lassen. Die königliche Macht ist sehr gering |
| ca. 1000 | Sigtuna entsteht |
| 1008 | König Olof Skötkonung lässt sich taufen. Dennoch sind bis ins 12. Jahrhundert große Teile der Bevölkerung heidnisch. |
| 12. - 13. Jh. | Die Expansionspolitik nach Osten wird wieder aufgenommen. Das Ziel ist, sich Finnland einzuverleiben, aber diesmal nicht in Form von Wikingerzügen, sondern – den neuen Anschauungen folgend - von mehreren Kreuzzügen |
| 1164 | Das Erzbistum Uppsala entsteht |
| 1248 | Kirchentreffen von Skänninge. Die Kirche erhält ihre eigene kanonische Kirchenordnung, welche ihre Unabhängigkeit von der weltlichen Macht vergrößert |
| 1288 | Gotland wird durch einen Vertrag an Schweden gebunden |
| 1335 | Abschaffung der weit verbreiteten Sklaverei |
| 1252 | Gründung der Stadt Stockholm |
| 1280 | Neben dem geistlichen Stand entsteht auch ein Reichsadel aus den Gefolgsleuten des Königs und der Stammesfürsten, dem in den Satzungen von Alsnö Steuerfreiheit bewilligt wird |
| 14. - 16. Jh. | Die Hanse beherrscht den Handel in Schweden |
| 1350 | Die alten Landesgesetze werden durch ein im ganzen Reich geltendes Gesetz ersetzt. |
| 1388 | Die dänische Königin Margaretha wird von einer aufständischen Adelsfraktion als schwedische Herrscherin anerkannt |
| 1389 | Nach dem Sieg über Albrecht werden Dänemark, Norwegen und Schweden unter einem Regenten vereinigt |
| 1997 | Margarethas Neffe Erich von Pommern wird zum König der drei Reiche gekrönt und die Kalmarer Union errichtet. Sie besteht bis 1523 |
| 1434 - 36 | Die Entmachtung des Reichsrates und eine zentralisierte, von Dänemark ausgehende Verwaltung mit hauptsächlich dänischen und deutschen Vögten führt – unterstützt von den Bauern, denen neue umfassende Steuern auferlegt werden – zum Engelbrekt-Aufstand. Die folgenden Jahrzehnte sind chaotisch und geprägt von inneren Kämpfen und häufigen Regierungswechseln |
| 1435 | Der erste "Riksdag" tritt zusammen, ein Parlament, in dem alle Volksklassen vertreten sind |
| 1477 | Die erste schwedische Universität in Uppsala wird gegründet |
| 1483 | Der Lübecker Drucker Johann Snell führt den Buchdruck ein |
| 16. Jh. | Die Zeit wird vom Kampf um die Herrschaft über das Baltikum geprägt. Der Zusammenbruch des Deutschen Ordensstaates führt zu einem Wettrennen um die Herrschaft über dessen Gebiete |
| 1520 | Kristian II. besiegte seine schwedischen Widersacher und lässt im November des selben Jahres etwa hundert Oppositionelle im sogenannten Stockholmer Blutbad hinrichten, darunter Erik Johansson und Joakim Brahe, Gustav Wasas Vater und Schwager. Dies führt zum Aufstand des Gustav Wasa |
| 1521 | Gustav Wasa wird zum Reichsverweser ernannt, was zum endgültigen Zusammenbruch der Kalmarer Union führt |
| 1523 | Gustav Wasas Aufruhr wird aktiv von Lübeck unterstützt und mit dessen Hilfe kann er Stockholm einnehmen. Gustav Wasa, wird zum König gewählt. Er begründet den modernen Staat mit Zentralregierung, stehendem Heer, Finanzverwaltung und dem König als Oberhaupt der protestantischen Kirche. Gegen den Willen des Hochadels wird das Erbfolgerecht des Königstitel eingeführt |
| 1533 | Die Abhängigkeit von Lübeck wird beendet |
| 1560 | Tod Gustav Wasas |
| 1561 | Estland stellt sich unter schwedischen Schutz |
| 1563 | Dreikronenkrieg. König Christian III. macht sein Missfallen über die Loslösung Schwedens deutlich, indem er die drei Kronen, welche als schwedisches Wappen gelten, in sein eigenes Wappen einfügt. Dies wird von schwedischer Seite als Beweis gesehen, dass Dänemark fortwährend Anspruch auf Schweden erhebt. |
| 1570 | Frieden von Stettin, Schweden lässt seinen Anspruch auf Schonen, Halland, Blekinge und Gotland fallen |
| 1593 | Der lutherische Glauben wird auf der Versammlung von Uppsala vom Reichsrat und der Priesterschaft als Staatskirche eingeführt. |
| 1611 - 13 | Kalmarkrieg. Offiziell geht es um den Titel des "Königs der Lappen", den sowohl der dänische Herrscher Christian IV. als auch der schwedische König Karl IX. für sich beanspruchen. Tatsächlich sind jedoch wirtschaftliche Interessen ausschlaggebend, da der Handel mit Fisch und Fellen aus der zu Schweden gehörenden und von Dänemark beanspruchten Finnmark im Norden Skandinaviens höchst einträglich ist |
| 1611 | Der erst 17-jährige Gustav II. Adolf übernimmt nach dem Tode seines Vaters die Herrschaft. Ihm gelingt es, die Ostseepolitik fortzuführen und Ingermanland und Kexholm (das Gebiet westlich und nördlich des Ladogasees) sowie Livland von Polen-Litauen zu erobern |
| 1613 | Durch die Vermittlung Englands und der Niederlande kommt zum Frieden von Knäred. Schweden musst die Finnmark an Dänemark abtreten. Zwar erhält es Kalmar zurück, musst jedoch bis 1618 eine Million Taler Entschädigung an den dänischen König Christian IV. zahlen. Bis zur endgültigen Bezahlung im Jahre 1619 bleibt die Festung Älvsborg in dänischer Hand. |
| 1630 | Gustav II. Adolf wendet sich Deutschland zu, das sich im Dreißigjährigen Krieg befindet. Schweden fällt auf der Seite der Protestanten in Pommern ein |
| 1632 | König Gustav II. Adolf fällt in der Schlacht von Lützen (bei Leipzig). |
| 1643 - 45 | Krieg mit Dänemark. |
| 1644 | Krieg gegen Polen, dem sich auf Feindesseite Dänemark und Russland anschließen |
| 1645 | Im Frieden von Brömsebro erhält Schweden die Provinzen Gotland, Jämtland, Härjedalen und Halland |
| 1648 | Der Westfälische Friede führt zum Erwerb von Bremen-Verden, Wismar, Vorpommern und anderen Gebieten |
| 1657 | Krieg mit Dänemark |
| 1658 | Frieden von Roskilde. Zwischen
Dänemark-Norwegen und
Schweden geschlossen. Er beendet den
1657 begonnenen
dänischen
Krieg gegen Schweden unter
Karl Gustav X.
Dänemark muss seinen Besitz im heutigen Südschweden räumen. Schweden erhält dadurch mit den Landschaften Schonen, Blekinge und Halland Zugang zum Öresund und zum Kattegat. Zudem gewinnt Schweden die norwegischen Provinzen Bohuslän und Trondheim sowie die dänische Ostseeinsel Bornholm. |
| 1660 | Frieden von Kopenhagen. Trondheim und Bornholm fallen wieder in dänischen Besitz über |
| 1675 | Schonischer Krieg . Dänemark erklärt Schweden den Krieg. In der ersten Phase des Krieges richtet sich der Angriff der Verbündeten Dänemark und Brandenburg gegen die schwedischen Besitzungen in Deutschland. Vorpommern, Wismar, Bremen-Verden und Stettin werden innerhalb kurzer Zeit eingenommen. |
| 1674 |
Schwedisch-Brandenburgischen Krieg
Schwedische Truppen marschieren auf Druck ihres Verbündeten Frankreichs in die Uckermark ein. Die brandenburgische Armee, von diesem Angriff überrascht, befindet sich noch in Franken, wo sie an der Seite der Vereinigten Niederlande gegen Frankreich kämpft |
| 1675 | Schwedische Truppen besetzen die Stadt Brandenburg. Im Juni 1675 kann Feldmarschall Georg von Derfflinger die Schweden in der Schlacht von Rathenow besiegen |
| 1676 | Eine holländisch-dänische Flotte
in der Ostsee siegt unter der Führung des holländischen Admirals Cornelis
Tromp über die schwedische Flotte in einer Seeschlacht an der Südspitze von
Öland wodurch sie die Seeherrschaft
erlangte. Öland wurde von dänischen Truppen besetzt. Dänische Truppen setzen nach Schonen über, wo sie zwischen Råå und Helsingborg an Land gehen und innerhalb weniger Monate ganz Schonen mit Ausnahme Malmös sowie Teile Blekinges erobern. Gleichzeitig marschiert eine dänisch-norwegische Armee von Norwegen aus entlang der Küste in Richtung Göteborg, verheert Uddevalla und Vänersborg, kommt aber an der Festung Bohus zum Stehen. Frieden von Saint-Germain. Friedrich Wilhelm muss Vorpommern wieder an Schweden abtreten, da ihn seine Verbündeten, die Niederlande und auch der deutsche Kaiser Leopold I., im Stich lassen und er mit Dänemark nun allein Frankreich gegenübersteht |
| 1700 | Dänemark, Polen-Sachsen und Russland beginnen den Großen Nordischen Krieg, der nach anfänglichen schwedischen Erfolgen unter König Karl XII. schließlich zum Zusammenbruch der Großmacht führt. Das Baltikum und beinahe alle anderen Gebiete südlich der Ostsee gehen verloren. |
| 1719 | Eine neue Verfassung wird durchgesetzt, die dem Reichstag die alleinige Gesetzgebung überträgt. Der Reichstag setzt sich nach wie vor aus den vier Ständen (Adel, Priester, Bürger und Bauern) zusammen. Da im Reichstag das Mehrheitsprinzip gilt, das heißt dass ein Beschluss nur dann gefasst werden kann, wenn drei der vier Stände dafür stimmen, entwickelt sich eine lebhafte politische Aktivität, die an den modernen Parlamentarismus erinnert. Doch fehlt ein grundlegendes Demokratieverständnis. Politische Gegner werden manchmal ins Gefängnis geworfen und Hinrichtungen kommen auch vor. |
| 1720 | Der Adel herrscht in Schweden, der König ist ohne Macht |
| 1721 | Der Friede von Nystad beendet die schwedische Großmachtzeit.
Schweden muss die Provinzen Livland, Estland und Ingermanland sowie einen Teil Kareliens an Russland abtreten. Weiterhin werden die Städte und Festungen Riga, Dünamünde, Pernau, Reval, Dorpat, Narva, Wiburg und Kexholm, sowie diverse Inseln - unter anderen Ösel, Dagö und Mön - und andere Gebiete ab der kurländischen Grenze und entlang der Ostsee Russland überlassen. Im Gegenzug musst Russland die besetzten Gebiete Finnlands an Schweden abtreten und Reparationen in Höhe von zwei Millionen Reichstalern zahlen. Außerdem erhält Schweden "auf ewige Zeiten" das Recht, in Riga, Reval und Arensburg Getreide im Wert von 50.000 Rubel alljährlich zollfrei aufzukaufen. |
| 1766 | Die Tryckfrihetsförordningen ("Druckfreiheitsverordnung", Gesetz über die Pressefreiheit) wird erlassen |
| 1772 | König Gustav III. stellt mit einem Staatsstreich die absolute Macht des Königs wieder her |
| 1774 | Die Pressefreiheit wird eingeschränkt, weder Politik noch Staatskirche und Religion dürfen diskutiert werden |
| 1792 | Ermordung des Königs beim Maskenball in der Oper |
| 19. Jh. | Auswanderungswelle. 1,2 Millionen Schweden das Land |
| 1809 | Schweden verliert im Krieg gegen Russland Finnland, das mehr als 600 Jahre zu Schweden gehört hatte; Absetzung des Königs Gustav IV. Adolf. Auf dem Reichstag wird beschlossen, Gustav IV. Adolf und seine Nachkommen von der Thronfolge auszuschließen. An dessen Stelle wird sein Onkel Karl zum König gewählt |
| 1814 | Im Frieden von Kiel muss Dänemark Norwegen im Austausch für Schwedisch-Pommern an Schweden abzutreten. Als daraufhin Norwegen seine Unabhängigkeit erklärt, erzwingt Karl XIV. Johann durch einen kurzen, fast unblutigen Feldzug die Gründung der schwedisch-norwegischen Union, wobei Norwegen ein eigenständiges Königreich bleibt und Karl hier den Titel Karl II. von Norwegen führt |
| 1818 | Schweden tritt seine Besitzungen in Pommern an Preußen ab |
| 1865 | Der Vierständereichstag durch ein Zweikammernparlament ersetzt |
| 1866 | Schweden wird ein konstitutioneller Rechtsstaat. |
| 1870 | Durchbruch der Industrialisierung |
| 1901 | Erstmalige Vergabe der Nobelpreise in Stockholm und Kristiania (Oslo) |
| 1905 | Die seit 1814 bestehende Personalunion mit Norwegen wird aufgelöst. |
| 1932 | Per Albin Hansson erster sozialdemokratischer Ministerpräsident. Seitdem stellt diese Partei fast alle Regierungschefs. |
| 1938 | Saltsjöbadenabkommen, das den sozialen Frieden sichern soll. Beginn des Aufbaus eines Wohlfahrtstaates |
| 1973 | Schweden erhält eine neue Verfassung |
| 1986 | Ermordung von Ministerpräsident Olof Palme |
| 1991 | Schweden beantragt Aufnahme in die EG |
| 1992 | Die Wirtschaftskrise erreicht auch Schweden. Verluste bei den Banken. Steigende Arbeitslosigkeit |
| 1995 | Eintritt Schwedens in die Europäische Union |
| 2003 | Ermordung der
Außenministerin Anna Lindh In einem Referendum spricht sich die Mehrheit (56%) gegen die Einführung des Euro aus |
Die schwedische Flagge
Nationalflagge
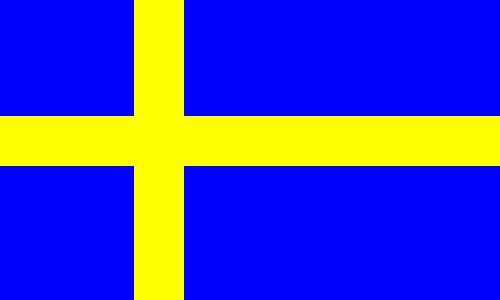
Die schwedische blaugelbe Flagge gab es wahrscheinlich schon im Jahr 1200. Sie hat also eine sehr lange Geschichte, den ältesten Beweis stellt allerdings eine blaue Decke mit einem gelben Kreuz darauf dar, welche aus dem 16. Jahrhundert stammt. Die beiden Farben stammen aus dem schwedischen Staatswappen, einem blauen Untergrund mit einem gelben Löwen, das Muster ist dem des dänischen Dannebrog nachempfunden.
König Johann III. äußerte 1569 den Wunsch, dass das im großen Wappen geführte Kreuz für alle Fahnen und Banner im Reich vorkommen sollten. Ein Flaggengesetz von 1663 setzte den heute noch üblichen Grundtyp der Flagge fest. Um anzuzeigen, dass der König von Schweden im 19. Jahrhundert teilweise gleichzeitig in Norwegen herrschte, war damals lange Zeit ein Unionszeichen in der Gösch vorhanden, das eine Kombination aus der schwedischen und der norwegischen Flagge darstellte. Offiziell eingeführt wurde die heutige Flagge am 22. Juni 1906.
Königsflagge
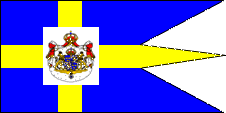
Wappen
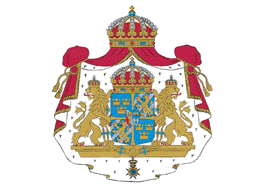
Das große Staatswappen ist das Wappen des Monarchen und wird bei feierlichen Anlässen vom Reichstag und von der Regierung genutzt. Die Komposition wurde schon um 1440 als Siegel geschaffen und wird seitdem fast unverändert benutzt. Das Wappen besteht aus dem Feld mit den drei Kronen, das mit den „Folkunger“-Löwen, d.h. dem Wappen des Geschlechts der Folkunger zusammengestellt wird. Das Herzschild zeigt das Wappen des regierenden Hauses, d.h. heute das um 1810 für den neugewählten Kronprinzen, den französischen Marschall Jean Baptiste Bernadotte, geschaffene Wappen. Dieses enthält eine „Wasa-Garbe“, die an das Haus Wasa erinnert, und eine Brücke, die das Fürstentum Ponte Corvo in Italien repräsentiert, welches Napoleon Bernadotte schenkte. Das Wappen wird durch den napoleonischen Adler und sieben Sterne ergänzt.
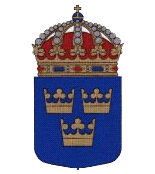
In den meisten Fällen wird das kleine Staatswappen benutzt. Es besteht aus drei offenen Kronen in Gold auf blauem Feld, von denen zwei über der dritten angeordnet sind, und einer Königskrone als Krönung über diesen. Eventuell ist es auch von der Kette des Seraphinenordens eingerahmt. (Der 1748 gestiftete Seraphinenorden ist der höchste schwedische Orden.) Das Wappen mit den drei Kronen ist spätestens seit 1336 als Symbol für Schweden benutzt worden. Drei Kronen waren zu der Zeit seit langem ein bekanntes Zeichen für die „Heiligen Drei Könige“. Nach einer Theorie nahm König Magnus Eriksson (1319–64) das Symbol in Anspruch, um seinen Titel „König von Schweden, Norwegen und Schonen“ zu illustrieren.
Historische Flaggen

Im Jahr 1814 kahm es zur Union zwischen Schweden und Norwegen,es wurde eine neue Staats- und Kriegsflagge für beide Staaten eingeführt: die schwedische Flagge mit einem weißen Kreuz auf rotem Grund in der linken oberen Ecke. 1818 erhielten die beiden Staaten zusätzlich eine Handelsflagge, die auch in fernen Gewässern jenseits des Kap Finisterre benutzt werden konnte, da Schweden Schutzgelder an die nordafrikanischen Piraten zahlte.
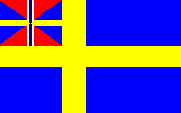
1844 wurde eine "Unions-Oberecke" für die norwegischen und schwedischen Flaggen geschaffen. Sie kombinierte in einer diagonalen Vierteilung das schwedische und norwegische Kreuz. Die schwedischen und norwegische Flaggen zeigten somit jeweils die "Unions-Oberecke", und verdeutlichten so die Personalunion zwischen den Monarchien beider Länder. Die Flagge war bis 1906 in Gebrauch.
Die schwedische Sprache
Schwedisch (svenska) gehört zu den skandinavischen Sprachen und somit auch zu den germanischen Sprachen. Die germanischen Sprachen sind Teil der indogermanischen Sprachfamilie.
Schwedisch ist Amtssprache in Finnland (neben Finnisch). In Schweden besitzt sie keinen offiziellen Status, und ist nur die offizielle Sprache de facto.
Schwedisch wird von etwa 8,5 Millionen Menschen als Muttersprache gesprochen, von denen etwa 8,0 Millionen in Schweden und knapp 290.000 als Finnlandschwedische Minderheit (5,5 % der Bevölkerung) in Finnland leben. Von der ehemaligen schwedischsprachigen Volksgruppe in Estland, die so genannten Estlandschweden (Anfang der 1940er Jahre um 6.800) bleiben seit ihrer Massenemigration nach Schweden während des Zweiten Weltkriegs nur noch einzelne ältere Menschen. Außerdem wird schwedisch von etwa 1 Million Einwanderern in Schweden gesprochen.
Schwedisch und finnisch sind in Finnland gleichberechtigte Amtssprachen. Es gibt in Uusimaa (Nyland) und Itä-Uusimaa (Öster-Nyland) einige hauptsächlich schwedischsprachige Gemeinden, in Österbotten (Pohjanmaa) Gemeinden, die überwiegend schwedischsprachig sind, sowie mehrere einsprachig schwedische Gemeinden. Die schwedischsprachigen Bewohner Finnlands werden in der Schule in ihrer Muttersprache unterrichtet, für die finnischsprachigen Bewohner ist schwedisch Pflichtfach als Fremdsprache. In Turku befindet sich die einzige rein schwedischsprachige Universität Finnlands, die Åbo Akademi.
Die autonome Inselgruppe Åland ist die einzige offiziell einsprachige Region im sonst zweisprachigen Finnland: Hier wird nur schwedisch gesprochen, und finnisch ist nur ein Wahlfach (englisch aber ein Pflichtfach). Das hier gesprochene åländisch ist dem Reichsschwedischen zuzuordnen, und weist Einflüsse aus dem norrländska und gutamål auf.
Das auf Gotland gesprochene gutnisch oder gutamål gilt als eine eigenständige germanische Sprache. Es darf nicht mit gotländisch (gotländska) verwechselt werden, welches ein vom gutnischen beinflusster schwedischer Dialekt ist.
Die in Schonen (Skåne) gesprochene schonische Sprache (skånska) wird häufig auch zu den dänischen Dialekten gezählt, da sie Merkmale sowohl mit dem schwedischen auch als mit dem dänischen teilt.
Schweden können sich relativ problemlos mit Norwegern und (wenn jene sich Mühe geben, deutlich zu sprechen) Dänen unterhalten. Hierbei gibt es allerdings regionale Unterschiede. So verstehen die Schweden im Süden, vor allem in Skåne, wegen der nahen Verwandtschaft ihres Dialekts mit dem dänischen die Dänen relativ gut. Einwohner in Westschweden (beispielsweise in Värmland oder Dalarna) haben dagegen große Probleme mit dem dänischen, dafür aber kaum Schwierigkeiten mit dem norwegischen.
Während des Mittelalters unterlag die schwedische Sprache, genauso wie auch die norwegische Sprache deutlichen Einflüssen aus dem Mittelniederdeutschen der Hanse. In der Neuzeit kamen Einflüsse des Hochdeutschen hinzu, teils durch den Handel mit Deutschland, bzw. dem Deutschen Reich, und dem Baltikum, teils durch den Dreißigjährigen Krieg und die daher zurückkehrenden Soldaten, welches besonders offensichtlich durch die vielen Lehnwörter im Militärjargon wird. Doch auch die Dominanz der deutschen Sprache in manchen Wissenschaften prägte den schwedischen Wortschatz.
Umgekehrt hinterließ die schwedische Sprache während der schwedischen Herrschaft über Teile Norddeutschlands, im Raum Stade und Vorpommern deutliche Einflüsse auf die niedersächsische Sprache und die ostniederdeutsche Sprache. Speziell das Nordniedersächsische, Mecklenburgische und Westpommersche wurden stark davon beeinflusst.
Das schwedische Alphabet besteht aus 29 Buchstaben. Das W kommt in Lehnwörtern vor und galt bis 2006 nicht als eigener Buchstabe sondern als Schreibvariante des V. Nach dem Z folgen noch Å, Ä, Ö, die als eigenständige Buchstaben gezählt werden und nicht wie im Deutschen als Varianten von A und O. Die schwedischen Wörterbücher sind deswegen entsprechend geordnet und für Deutsche anfänglich etwas verwirrend. So stehen z.B. garn und gärna nicht hintereinander, sondern mehrere Seiten weit auseinander.
Die schwedischen Könige
| König/in | Zeitraum | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Erik VIII. Segersäll, der Siegesfrohe | 970 - 995 | |
| Olof Skötkonung | 995 - 1022 | |
| Anund Jakob | 1022 - 1050 | |
| Emund den gamle, der Alte | 1050 - 1060 |
| König/in | Zeitraum | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Stenkil Ragnvaldsson | 1060 - 1066 | |
| Halsten | 1067 - 1070 | |
| Haakon Röde, der Rote | 1070 - 1079 | |
| Inge I. den äldre, der Ältere |
1080 -
1084 und 1087 - 1105 |
|
| Blot-Sven, Opfer-Sven | 1084 - 1087 | |
| Philipp, Filip Halsten | 1105 - 1118 | |
| Inge II. den yngre, der Jüngere | 1118 - 1125 | |
| Magnus den starke, der Starke | 1125 - 1130 |
| König/in | Zeitraum | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Sverker I. den äldre, Sverker der Ältere | 1130 - 1156 | (Haus Sverker) |
| Erik IX. den helige, Erik Jedvarsson der Heilige | 1156 - 1160 | (Haus Erik) |
| Karl VII., Karl Sverkersson | 1161 - 1167 | (Haus Sverker) |
| Knut I., Knut Eriksson | 1167 - 1196 | (Haus Erik) |
| Sverker II. den yngre, Sverker der Jüngere Karlsson | 1196 - 1208 | (Haus Sverker) |
| Erik X., Erik Knutsson | 1208 - 1216 | (Haus Erik) |
| Johann I., Johann Sverkersson | 1216 - 1222 | (Haus Sverker) |
| Erik XI. läspe och halte, Erik der Lispelnde und Lahme Eriksson |
1222 -
1229 und 1234 - 1250 |
(Haus Erik) |
| Knut II., Knut Långe | 1229 - 1234 | (Ratsmitglied) |
| König/in | Zeitraum | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Waldemar I., Waldemar Birgersson | 1250 - 1275 | |
| Magnus I., Magnus Birgersson Ladulås (Scheunenschloß) | 1275 - 1290 | |
| Birger I., Birger Magnusson | 1290 - 1318 | |
| Magnus II., Magnus Eriksson | 1319 - 1364 | (1356-1359 mit seinem Sohn Erik XII. als Mitregenten) |
| König/in | Zeitraum | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Albrecht von Mecklenburg | 1364 - 1389 |
| König/in | Zeitraum | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Margarethe I. | 1389 - 1412 | |
| Erik XIII. auch Erik VII. von Dänemark, Erich der Pommer | 1412 - 1439 | |
| Christoph III. von Bayern | 1440 - 1448 | |
| Karl VIII. Knutsson Bonde |
1448 -
1457, 1464 - 1465 und 1467 - 1470 |
|
| Christian I. von Oldenburg | 1457 - 1464 | |
| Johann II. auch Johann I. von Dänemark, Hans | 1497 - 1501 | |
| Christian II., der Tyrann | 1520 - 1521 |
| König/in | Zeitraum | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Sten Sture der Ältere |
1470 -
1497 und 1501 - 1503 |
|
| Svante Sture | 1504 - 1512 | |
| Erik Trolle | 1512 | |
| Sten Sture der Jüngere | 1512 - 1520 |
| König/in | Zeitraum | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Gustav I. Wasa | 1521 - 1523 | (als Reichsverweser) |
| Gustav I. Wasa | 1523 - 1560 | |
| Erik XIV. | 1560 - 1568 | |
| Johann III. | 1568 - 1592 | |
| Sigismund | 1592 - 1599 | |
| Karl IX. | 1599 - 1611 | |
| Gustav II. Adolf | 1611 - 1632 | |
| Christine | 1632 - 1654 |
| König/in | Zeitraum | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Karl X. Gustav | 1654 - 1660 | |
| Karl XI. | 1660 - 1697 | |
| Karl XII. | 1697 - 1718 | |
| Ulrike Eleonore | 1718 - 1720 |
| König/in | Zeitraum | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Friedrich I. | 1720 - 1751 |
| König/in | Zeitraum | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Adolf I. Friedrich | 1751 - 1771 | |
| Gustav III. | 1771 - 1792 | |
| Gustav IV. Adolf | 1792 - 1809 | |
| Karl XIII. | 1809 - 1818 |
| König/in | Zeitraum | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Karl XIV. Johann | 1818 - 1844 | |
| Oskar I. | 1844 - 1859 | |
| Karl XV. | 1859 - 1872 | |
| Oskar II. | 1872 - 1907 | |
| Gustav V. | 1907 - 1950 | |
| Gustav VI. Adolf | 1950 - 1973 | |
| Carl XVI. Gustaf | seit 1973 |
Die schwedische Nationalhymne
Der Text von „Du gamla, du fria" wurde von dem Volkskundler und Liederdichter Richard Dybeck (1811–77) geschrieben und in der Mitte des 19. Jahrhunderts der Melodie eines Volksliedes aus der Provinz Västmanland unterlegt. Um die Jahrhundertwende wurde das Lied immer häufiger gesungen und im Laufe der Zeit allgemein als die schwedische Nationalhymne betrachtet.
Das Lied ist eine feierliche Hymne mit einer Anspielung auf vergangene Zeiten und stellt eine Huldigung an die Freiheit und Schönheit der Natur des Nordens dar.
Du gamla, du fria
Du gamla, du fria, du
fjällhöga Nord,
Du tysta, du glädjerika sköna!
Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, din himmel, dina ängder gröna.
Din sol, din himmel, dina ängder gröna.
Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat ditt namn flög över jorden.
Jag vet att du är och du blir, vad du var.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.
Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,
din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,
Din fana, högt den bragderika bära.
Din fana, högt den bragderika bära.
Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Du alter, Du freier:
Du alter, Du freier,
Du berghoher Norden,
Du stiller, Du freudenreicher Schöner!
Ich grüße Dich freundlichstes Land auf Erden,
Deine Sonne, Deinen Himmel, Deine grünen Wiesen.
Deine Sonne, Deinen Himmel, Deine grünen Wiesen.
Du glaubst an Erinnerungen aus
glorreichen Tagen,
als Dein Name verehrt durch die Welt zog.
Ich weiß, dass Du bist, und Du bleibst was Du warst.
Ja, ich will im Norden leben und sterben.
Ich will Dir immer dienen mein
geliebtes Land,
Die Treue schwöre ich Dir bis zu meinem Tode.
Dein Recht werde ich mit Haut und Haaren verteidigen,
Deine prachtvolle Fahne hoch tragen.
Mit Gott werde ich für Haus und
Hof kämpfen,
für Schweden, das geliebte Vaterland.
Ich tausche Dich gegen nichts in der Welt ein.
Nein, ich will im Norden leben und sterben.
Nein, ich will im Norden leben und sterben
